Der lange Weg nach Hause
("DIE ZEIT", 13.07.2006)
Vor sieben Jahren ist die Autorin Anja Reich von "DIE ZEIT" von Berlin nach New York gezogen. Die Rückkehr ist das größere Abenteuer.Treffender kann man das Leben hier in NYC und den Vergleich mit "good old Germany" nicht beschreiben - Deswegen: Have Fun beim Lesen !!! Peter.Vor ein paar Wochen habe ich Milan aus der Parallelklasse in New York wiedergesehen. Er sah nicht gut aus. Er trug ein kurzärmliges Oberhemd mit aufgesetzten Schulterstücken, darunter ein geriffeltes Unterhemd, an den Füßen Badelatschen. Alles an ihm hing. Die Schultern, die Haare, die Mundwinkel, vor allem die Mundwinkel. Er war blass, hatte dunkle Schatten unter den Augen, eine viel zu große Sonnenbrille auf der Nase und sagte Sachen wie: »Ist doch keine Sicherheit in diesen Centers hier.« Er sagte Ssssenters. Das haben selbst die New Yorker verstanden. Das ganze Kino hat gelacht.
Milan und ich sind zusammen zur Schule gegangen, auf die 26. Oberschule Berlin-Lichtenberg. Er war in der A-, ich in der B-Klasse. Ein Kleiner Unscheinbarer mit Brille. In der fünften Klasse ist er weggezogen. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß, dass ich nicht damit gerechnet habe, ihn jemals wiederzusehen. Oder einen von den anderen. Kristian hatte ich zuletzt als Schaffner auf dem Bahnhof Nöldnerplatz gesehen, Steffen soll Schließer im Gefängnis sein. Uwe ist tot. Drei Jahre vor meiner Abreise nach New York habe ich seine Todesanzeige in der Zeitung gelesen. Es klang nach Selbstmord.
Aus Berlin-Lichtenberg kamen keine Filmstars. Dachte ich. Bis ich Milan im Tribeca Cinema auf der Leinwand wiedersah. Er spielte die Hauptrolle. Es war bei einem Screening, das die Marketinggesellschaft German Films in Robert De Niros kleinem Programmkino veranstaltete, in der Hoffnung, den Film nach Amerika zu verkaufen. Oliver Mahrdt, der German Films in New York vertritt, hatte mir erzählt, er habe da was ganz Cooles ausgegraben. Netto sei von
einem Studenten der Filmhochschule Babelsberg, spiele im Osten und habe verschiedene Preise gewonnen. Mahrdt kommt aus Heidelberg, ist aber immer so braun, als käme er gerade aus der Karibik, trägt eierschalenfarbenen Sommeranzüge und Einstecktücher. Für ihn war Netto ein kleiner, verwackelter Film aus dem Osten. Für mich war er eine Zeitreise.
Ich saß im Kino in Tribeca, hörte unter mir den A-Train der New Yorker Subway anfahren, während vor mir auf der Leinwand die S-Bahn über die Bernauer Straße rumpelte und Milan Peschel aus der A auf einem alten Ostsofa saß und sich mit dem Finger im Ohr pulte.
Ich liebe diese kleinen Filmvorführungen in Tribeca. Ich habe hier Sommer vorm Balkon gesehen, Alles auf Zucker, Zeppelin und Der Rote Kakadu. Es gibt nichts Schöneres, als abends mit der Subway von Brooklyn über die Manhattan Bridge zu fahren, die Lichter der Wolkenkratzer zu sehen, die Canal Street entlangzulaufen, an den kleinen, voll gestopften chinesischen Läden vorbei, um dann in einen langsamen deutschen Film einzutauchen. Die Menschen auf der Leinwand sprechen meine Sprache, die Probleme sind mir vertraut, es ist meine Welt, aber ich kann jederzeit wieder aufstehen und rausgehen. In eine andere Welt.
Meine andere Welt.
Ich habe 21 Jahre lang in der DDR gelebt, zehn Jahre in der Bundesrepublik, 1999 bin ich nach Amerika gezogen, das ist mein siebtes Jahr in New York. Wenn man mich fragt, wo ich zu Hause bin, weiß ich keine Antwort.
Meinem Sitznachbarn im Flugzeug erzähle ich, dass ich in Berlin geboren bin. Ost oder West, fragen sie. Ost, sage ich. Dann kommt die Stewardess mit der Einreiseerklärung. Ich bekomme die weiße, die für Nichtamerikaner mit Visum. Bei Nationalität schreibe ich deutsch, bei Wohnsitz USA. Auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen stelle ich mich in die Schlange für Ausländer. Der Immigration Officer fragt streng, was der Zweck meiner Reise ist. Ich sage, dass ich in New York wohne und arbeite, dass hier meine Familie ist. Das ist meine Antwort.
»Warum haben Sie noch keine Green Card beantragt?«, hat mich einmal eine Frau gefragt.
Es war in Okemo, einem kleinen Skigebiet in Vermont, wo wir seit vier Jahren Winterurlaub machen. Mein Mann holte die Kinder aus der Skischule ab, ich saß im Lift und schwebte gerade über das Waffelhäuschen, die Frau neben mir kam aus Connecticut. Wir hatten uns über unsere Kinder unterhalten, auf welche Schulen sie gingen, wo wir wohnten, wo wir herkamen. Die Skilifte in Vermont sind sehr langsam. »Ich weiß auch nicht«, sagte ich. »Wir haben noch nie versucht, eine Green Card zu beantragen. Wir wollen eigentlich irgendwann wieder nach Deutschland zurückziehen.«
»Ich verstehe«, sagte die Frau, »einmal Deutsche, immer Deutsche.« Ich schluckte. Wahrscheinlich hatte sie mein Problem genau auf den Punkt gebracht. Aber ihre Bemerkung
traf mich. Sie klang abfällig. Das bin ich nicht gewohnt. Meine amerikanischen Freunde sind diplomatischer. Sie finden Berlin gut, sagen sie. Ihnen gefallen die alten Wohnungen mit den hohen Stuckdecken, die Museen, die Galerien, das Künstlerleben, die Trödelmärkte. Sie sagen, Berlin erinnere sie an das New York der sechziger Jahre, als die Stadt noch wilder und nicht so schick gewesen sei. Als Schröder gegen den Irak-Krieg war, haben sie mir gratuliert. Als Angela Merkel gewählt wurde, sagten sie, ich müsste sehr stolz sein, eine Frau als Kanzlerin zu haben. Sie verstehen, warum es uns zurückzieht. Sie beneiden uns um die Möglichkeit, in Europa und Amerika zu leben, verschiedene Kulturen kennen zu lernen. Bei unserer Abreise
damals aus Deutschland war das ein wenig anders gewesen. »Nach New York wollt ihr?«, fragten mich die Frauen meiner Babygruppe in Kreuzberg, als ich ihnen von unseren Umzugsplänen erzählte. Das war 1999, die Türme des World Trade Center standen noch, für sie klang es aber damals schon so, als würde ich ins Kriegsgebiet ziehen. Wir saßen auf einem Hinterhof, tranken Kaffee und aßen selbst gebackenen Streuselkuchen, die Kinder spielten mit Holzbausteinen. Ich sagte, dass es immer unser Traum gewesen sei, dort zu leben, und dass es auch in New York ganz gute Schulen geben solle. Sie sahen mich verständnislos an.
Deutsche ziehen nicht gerne um. Wer das Land verlässt, macht sich verdächtig. Ich muss aufpassen, was ich Bekannten in Berlin über mein Leben in New York erzähle. Aber die meisten fragen gar nicht erst. Vielleicht wollen sie nicht wissen, ob ich mich verändert habe. Vielleicht ist Veränderung für sie etwas Bedrohliches. »Bleib, wie du bist, dann wirst du sein, wie du warst«, hatten zwei Ostberliner Freunde vor unserem Umzug nach New York ins Abschiedsbuch geschrieben. »Nun lernt mal wieder Deutsch!«, stand auf einer Weihnachtskarte, die uns im dritten Amerika-Jahr erreichte.
Es klang wie ein Vorwurf. Bei meinem letzten Berlin-Besuch traf ich mich mit ein paar Freunden und Kollegen in einem italienischen Restaurant. Ich war erst am selben Morgen in Berlin gelandet und noch ein wenig durcheinander. Die Bestellung bei der italienischen Kellnerin hätte ich fast auf Englisch aufgegeben, und einmal rutschte mir »dinner« statt »Abendessen« raus.
»Es ist eine Unart der Deutschen, Anglizismen zu benutzen«, sagte der Mann einer Kollegin. Seiner Tochter sei das nicht passiert, erzählte er. Sie habe ein Jahr in Amerika verbracht, und ihre Sprache habe sich in der Zeit überhaupt nicht verändert.
»Oh, wirklich, aber warum denn nicht?«, fragte jemand. »Für meine Tochter ist Amerika das Land der Hundert-Wörter-Sprache«, sagte der Mann. Er war sehr stolz auf seine Tochter.
Ich saß vor meinem Glas Rotwein und sagte nichts. Es hat keinen Sinn. Ich kenne diese Gespräche. Auf einer Feier im letzten Sommer hat mir ein Ostberliner Musiker gesagt, dass er ja mal gespannt sei, wann die Amis endlich zugeben würden, dass hinter den Anschlägen vom 11.September in Wirklichkeit die CIA stecke. An dem Tag, als in Amerika das Stromnetz zusammenbrach, war ich auf dem Weg nach Deutschland. Meine Nachbarin erzählte mir am Telefon, dass in unserer Straße in Brooklyn die Leute mit Kerzen auf den Treppen saßen und grillten. In den deutschen Nachrichten hörte ich vor allem den Vorwurf heraus, dass das
amerikanische Energienetz völlig veraltet sei, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis so etwas passierte. In diesem Moment habe ich begriffen, warum es für das Wort Schadenfreude keine englische Übersetzung gibt.
Ein Bekannter, der jahrelang in Washington lebte und große Probleme hatte, sich wieder in Deutschland einzugewöhnen, hat mir kurz vor unserer Abreise gesagt, für ihn würden sich Deutsche nicht nach Ost und West unterscheiden, sondern nach Menschen, die mal im Ausland gelebt haben, und denen, die nie ihre Heimat verlassen haben. Damals habe ich nicht verstanden, was er meinte. Heute weiß ich, dass es eine wichtige Erfahrung ist, sein eigenes Leben einmal aus einer gewissen Distanz zu betrachten.
Wir sind am 13. Dezember 1999 in New York angekommen, mit dem Taxi fuhren wir über die holprige, kaum beleuchtete Atlantic Avenue zu unserer neuen Wohnung. Mein Mann flog noch in derselben Nacht weiter nach Texas. Ich blieb bei den Kindern. Am Morgen nach unserer Ankunft saß ich zwischen Umzugskisten im neuen Wohnzimmer in Brooklyn. Meine Kinder legten ein Puzzle zusammen. Ich stand am Fenster und guckte mir die Leute an, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Ich hatte keine Ahnung, wo wir hier eigentlich gelandet waren.
Ich hatte mich auf das weihnachtliche New York gefreut, das ich von Ansichtskarten kannte. Die große Tanne vorm Rockefeller Center, den Central Park im Schnee, das leuchtende Empire State Building. Als wir am Wochenende das erste Mal nach Manhattan fuhren, regnete es, die Schlange vorm Rockefeller Center war mehrere hundert Meter lang, Leute schubsten uns mit ihren großen Einkaufstüten zur Seite, der Gameboy, den mein Sohn sich so sehr wünschte, war ausverkauft. Auf dem Rückweg stiegen wir in den falschen Subway-Zug, weil ich die Ansagen nicht verstand. In diesem Moment begriff ich, worauf wir uns eigentlich eingelassen hatten, wie beschützt wir in Deutschland gewesen waren.
Ich hatte in der Schule Englisch gelernt. Ich dachte, ich würde einigermaßen klarkommen, aber in den ersten Wochen scheiterte ich an den einfachsten Dingen. Wenn ich einen kleinen Kaffee wollte, bekam ich einen großen. Einmal klingelte ein Mann an unserer Tür. Er trug eine braune Latzhose, hatte verschiedene Gerätschaften in der Hand und sagte, er sei von der »Pest Control«. Ich sagte: »Einen Moment bitte«, und holte meinen deutschen Pass. Der Mann sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Er war ein Kammerjäger. Mein Sohn behauptet, mein Englisch wäre so schlecht gewesen wie das einer russischen Immigrantin. Seins war nicht viel besser. Er war sieben. Als wir ihn auf der Public School in unserem Viertel meldeten, konnte er gerade mal sagen, wie er heißt, woher er kommt und was er gerne isst. Drei Monate lang saß er in der Schule und sagte kein einziges Wort. Als er wieder anfing zu sprechen, war sein Englisch fließend. Meine Tochter konnte überhaupt kein Englisch. Das war auch nicht nötig. Sie war nicht mal zwei, und der einzige freie Kindergartenplatz war bei »Bambi«, einer Kita, die von Russinnen und Georgierinnen betrieben wurde, die auch gerade in Amerika angekommen waren. Sie hießen Nina, Oksana und Natascha und hatten eine kleine Erdgeschosswohnung im italienischen Viertel von Brooklyn gemietet. Tagsüber spielten hier meine Tochter und amerikanische Kleinkinder mit Plastikautos, abends wurde das Spielzeug weggeräumt, die Babybetten wurden zusammengeklappt, und der Wodka wurde rausgeholt. Ich hatte mich bereits mit dem Gedanken abgefunden, dass meine Tochter genau wie ich Russisch als erste Fremdsprache lernen würde, da wurde bei uns um die Ecke ein Kindergartenplatz frei. Ich schrieb auf Russisch »Danke« auf eine Karte, eine der wenigen Vokabeln, die ich nicht vergessen hatte, Mascha malte ein Herz für Nina, ihre Lieblingserzieherin. Es war ein Abschied für immer. Als wir sie später noch einmal besuchen wollten, war sie nicht mehr da. Nina sei weggezogen, sagte Oksana, ihr Handy abgemeldet. Niemand wusste, wo sie war. Vielleicht macht sie irgendwo Karriere, vielleicht ist sie abgestürzt.
Auch das ist New York.
Meine Kinder gingen jetzt auf New Yorker Schulen. Ich hatte furchtbare Sachen über die öffentlichen Schulen in Amerika gehört. Dass die Kinder nichts lernten, die Lehrer schlecht ausgebildet seien, dass es Schießereien gebe. »Schicken Sie Ferdinand auf eine Privatschule!«, hatte mir die deutsche Lehrerin meines Sohnes kurz vor dem Umzug mit auf den Weg gegeben.
Die PS 321, die öffentliche Schule in unserem Viertel, war ein Betonkasten mit vergitterten Fenstern, aber im Klassenzimmer meines Sohnes gab es ein gemütliches Sofa und ein Klavier. Seine Lehrerin hieß Marilyn. Sie beschriftete das Klavier, das Sofa und die anderen Gegenstände in Deutsch und in Englisch und kaufte sich ein Wörterbuch, damit sie sich besser mit meinem Sohn verständigen konnte. Ferdinand mochte seine neue Schule vom ersten Moment an. Die Lehrer waren nicht so streng, der Unterricht nicht so förmlich wie in Berlin, alle versuchten, ihm das neue Leben zu erleichtern. Die Mutter einer Mitschülerin, eine Opernsängerin, schenkte ihm ein Mickymausheft auf Deutsch, das sie mal von einer Tournee mitgebracht hatte, Matthews Eltern luden ihn nach Hause ein, Derek, ein Nachbarsjunge, half ihm bei den Hausaufgaben. Es war als hätten alle nur auf unsere Ankunft gewartet. Auf dem Weg zur Schule wurden wir von wildfremden Menschen angesprochen, die gehört hatten, dass wir gerade erst hergezogen waren. Sie boten uns ihre Hilfe an, stellten uns anderen Deutschen vor, luden uns ein. Anfangs dachte ich, nur wir würden so freundlich empfangen. Bis ich die Geschichten anderer New Yorker hörte.
Ich erzähle meinen Freunden in Berlin davon, wenn sie mich fragen, was ich von den Amerikanern halte. Manche sehen mich an, als wäre ich selbst schon eine. Vielleicht haben sie Recht. »Hallo, wie geht´s?«, frage ich meine Kollegen, wenn ich in Berlin anrufe. Manchen verschlägt das die Sprache. Ich sitze in Brooklyn an meinem Schreibtisch, höre ihr Atmen am Telefon und spüre ihre Nöte. Es ist mitten am Arbeitstag, sie haben den Kopf voll, und ich frage sie völlig gedankenlos nach ihrem Befinden. Vielleicht ist gerade jemand gestorben oder entlassen worden, oder es gab Ärger mit dem Chef. Sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen.
»Na ja, geht so«, sagen sie nach einer Weile. »Könnte besser gehen.« Oder: »Unverändert.«
In New York müsste man sich nach so einer Auskunft ernsthaft Sorgen machen. New Yorker sagen: »Good.«
Oder: »Fine.«»Okay« heißt schlecht. »Not too bad« bedeutet miserabel.
Ich rede dann übers Wetter. »In New York scheint die Sonne, keine Wolke am Himmel«, rufe ich ins Telefon. »In Berlin sind 30 Grad«, sagt mein Redakteur. »Herrlichstes Sommerwetter«, erfahre ich von meiner Freundin. Das Wetter, habe ich festgestellt, gehört zu den wenigen Belanglosigkeiten, über die Deutsche sprechen können. Alles andere gilt als oberflächlich. Ich glaube, dass ich in dieser Hinsicht für viele eine Zumutung geworden bin. Ich werde nervös, wenn bei Familienfeiern alle stumm am Tisch sitzen und darauf warten, unterhalten zu werden. Ich habe keine Lust mehr, auf Partys bis um zwei Uhr morgens zu warten, um endlich ein vernünftiges Gespräch führen zu können, weil dann auch die Letzten aufgetaut sind. In New York dagegen sind mir Partys oft nicht lang genug. »Abendessen von 20 bis 22 Uhr« steht auf den Einladungen. Hochzeitsfeiern sind nach drei Stunden vorbei. Gerade wenn es gemütlich wird, muss man wieder gehen. Ich fühle mich oft hin- und hergerissen. In Berlin fehlt mir die Energie von New York, in New York sehne ich mich nach der Langsamkeit von Berlin. Ich sitze im Restaurant in Prenzlauer Berg und ärgere mich, dass der Kellner nicht kommt. In Brooklyn bringt er schon die Rechnung, wenn ich noch beim Nachtisch bin. Im
Prospect Park gehen mir die Eltern auf die Nerven, die ihre Kinder loben, nur weil sie mal alleine die Rutsche runtergerutscht sind. In Friedrichshain zucke ich zusammen, wenn ein Vater auf dem Spielplatz sein Kind anbrüllt. Mir kommen vor Rührung die Tränen, wenn ich im Flugzeug sitze und unter mir die flachen deutschen Landschaften sehe, manchmal ist es so diesig, dass ich Berlin erst sehe, wenn das Flugzeug auf der Landebahn aufsetzt. Wenn ich über New York fliege, sehe ich die Brücken, das Meer und die Skyline von Manhattan, der Himmel ist blau und hoch, und ich fühle mich federleicht.
Als ich das erste Mal nach meinem Amerika-Umzug nach Berlin zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, die Stadt wäre in meiner Abwesenheit geschrumpft. Alles war so klein, so flach, so langsam und so leise. Nachts lag ich schlaflos im Bett meiner Mutter in Köpenick und vermisste das Rauschen New Yorks. Um vier Uhr morgens steckte ich mir die Ohrstöpsel aus dem Flugzeug so tief in die Ohren, bis es rauschte. Nach zwei Wochen flog ich wieder zurück, ins laute, verrumpelte New York. Auf den Bürgersteigen lagen Müllsäcke herum. Im Haus gegenüber wurde gerade ein Mann nach einer Messerstecherei abgeholt. In unserem Wohnzimmer lag ein toter Vogel, den unsere Katze erlegt hatte, die Blumen auf dem Balkon waren vertrocknet, obwohl die Nachbarin versprochen hatte, sie zu gießen. Ich setzte mich in den Sessel, rief meine Mutter an und sagte, dass wir bestimmt nicht mehr lange in New York bleiben würden.
Das war vor sechs Jahren.
Ich werde oft gefragt, wo ich mich wohler fühle, in Berlin oder in New York. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin immer noch froh, überhaupt die Wahl zu haben. Ich komme aus dem Osten. Ich bin am Nöldnerplatz aufgewachsen, in einer niedrigen Zweieinhalbzimmerwohnung, die in den dreißiger Jahren für Reichsbahnbeamte gebaut worden war. In unserer Straße gab es eine Drogerie und einen Bäcker, wo man Zuckerkuchen und das beste Brot der Welt kaufen konnte. Auf unserem Hof stand ein kleines Heizhaus. Morgens bin ich vom Schippen der Heizer wach
geworden; wenn meine Mutter die Fensterbretter abwischte, war der Lappen schwarz, aber dafür hatten wir warmes Wasser und brauchten keine Kohlen zu schleppen.
Meine Schule war im Hans-Loch-Viertel, einem Siebziger-Jahre-Plattenbaugebiet, in dem Familien aus verschiedensten sozialen Schichten wohnten. Die Eltern meiner Mitschüler waren Arbeiter, Antiquitätenhändler, Hausfrauen, Diplomaten, Professoren. Wir haben viele Klassenfahrten gemacht und viel gelacht, zumindest kommt mir das heute so vor. Manche meiner Mitschüler können sich an jede einzelne Unterrichtsstunde erinnern. Bei mir ist fast alles weg. Ich erinnere mich, dass mir einmal auf dem Hof die Großen die Mütze weggenommen und in die Mülltonne geworfen haben, dass Frau Huhn, unsere Geografielehrerin, uns in der letzten Stunde vor den Ferien Edgar Allan Poe vorlas, was ich liebte. In der dritten Klasse fragte uns unsere Lehrerin, welche Jahreszeit die schönste sei. Einer sagte Frühling, ein anderer Winter, ich sagte Sommer. Meine Lehrerin war nicht zufrieden. Sie fragte weiter. Irgendwann sagte jemand Herbst. Aber Herbst stimmte auch nicht. Unsere Lehrerin ließ uns die Auflösung in die Hefte schreiben: Alle Jahreszeiten sind schön.
Ich hatte damals häufig das Gefühl, etwas Falsches zu sagen, zu denken, zu machen. Bis vor kurzem dachte ich, das hatte mit der DDR zu tun. Bis ich vor drei Jahren mit meiner Tochter in Berlin auf einem Kinderfest war. Alle möglichen Kunstvereine hatten Stände aufgebaut. Meine Tochter war erst begeistert, fühlte sich dann aber irgendwie eingeengt. Beim Malen gab es Schablonen, beim Basteln mit Keramik musste sie sich für eine Tierform entscheiden, die sie nur noch bemalen durfte. Meine Tochter wollte nicht mit Schablonen malen und Keramik-Igeln Mund und Nase aufzeichnen. Sie ist keine Vorgaben gewöhnt. Sie malt und bastelt, was ihr in den Kopf kommt. In ihrer New Yorker Schule hat sie gelernt, dass man in der Kunst keine Fehler machen kann.
Deutsche wollen alles richtig machen. New Yorker versuchen das gar nicht erst. Es gibt hier so viele unterschiedliche ethnische Gruppen, Religionen und Kulturen. Es ist unmöglich, sich auf einen Standpunkt zu einigen. Wenn wir diskutieren, hören sie sich meine Ansicht ruhig an und sagen dann, was sie davon halten. Es scheint sie weder zu überraschen noch zu ärgern, dass ich anders denke als sie. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dem Q-Train von Brooklyn nach Manhattan fuhr. In Coney Island stiegen Russen ein, am Ocean Parkway orthodoxe Juden, in Park Slope kamen weiße Mittelstandfamilien dazu, in der Atlantic Avenue Araber und in der Canal Street Chinesen. Die Subway-Fahrt dauerte gerade mal 45 Minuten, aber sie kam mir vor wie eine Weltreise. Meine Freundin Debra amüsiert sich heute noch darüber, wie erschrocken ich war, als sie mir erzählte, dass sie Jüdin ist. Sie behauptet, ich hätte mich bei ihr sofort für die Verbrechen der Deutschen entschuldigt, obwohl aus ihrer Familie niemand im Holocaust
gestorben ist. Ich glaube, sie übertreibt ein wenig, aber nie werde ich vergessen, wie ich zum ersten Shabbat-Dinner meines Lebens Krabben als Vorspeise mitgebracht habe, weil ich nicht wusste, dass Schalentiere nicht koscher sind. Die Gastgeber haben die Krabben tapfer aufgegessen und mir versichert, dass sie nicht besonders religiös seien. Aber vermutlich reden sie heute noch über mich. Die Deutsche mit den Schalentieren.
Als wir später einmal zum Chanukka-Feiern eingeladen waren und der Gastgeber an alle männlichen Gäste jüdische Kappen verteilte, war mein Mann der Erste, der seine aufhatte, und der Letzte, der sie wieder abnahm. Wir bemühen uns immer noch, keine Fehler zu machen, aber langsam werden wir gelassener.
Zu Weihnachten laden wir unsere Freunde zu uns nach Hause ein. Meine schwedische Freundin bringt Lachs und selbst gebackenes Brot mit, ich mache Würstchen mit Kartoffelsalat. Gegen sieben rumpelt es auf dem Dach. Dann steigt Mike, unser irischer Nachbar, der Santa Claus spielt, schnaufend die Dachluke hinunter und verteilt Geschenke. Mike ist weniger streng als die deutschen Weihnachtsmänner. Nie fragt er die Kinder, ob sie auch artig waren, dafür lässt er sich zum Schluss gerne mit den weiblichen Gästen fotografieren, mit den Männern trinkt er Whiskey. Zum Festtagssingen gehen wir immer in die Old First Reformed Church, das ist eine protestantische niederländische Kirche, deren Pfarrer im Gottesdienst für den amerikanischen Präsidenten und das Kyoto-Abkommen betet. Für ihn ist das kein Widerspruch. An diesem Abend aber wird nicht gebetet. Der Chor unserer jüdischen Nachbarin singt Gospels, der Kirchenchor das deutsche Weihnachtslied Still, still, still, weil´s Kindlein schlafen will. Alle in der Kirche singen mit, laut und falsch. Auch bei Imagine oder den
Eight Days of Chanukah, die vom schwarzen Highschool-Mädchenchor angestimmt werden. Das ist das Finale. Sechs dicke, hüftenschwingende Mädchen stehen unter Jesus am Kreuz und singen John Lennon. Sie haben wunderbare Stimmen. Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber in diesen Momenten liebe ich New York, ich kann mir sogar vorstellen, für immer hier zu bleiben. Ich muss mich hier nicht festlegen, das ist das Angenehme. Ich bin Ostdeutsche, Deutsche, Europäerin, New Yorkerin.
Vor einem halben Jahr bekam ich eine Einladung zum Klassentreffen mit meinen Lichtenberger Mitschülern. Auf der Postkarte war unsere Schule im Hans-Loch-Viertel abgebildet. Wir hatten 1984 die Schule beendet, fünf Jahre später war die Mauer gefallen, also genau zu dem Zeitpunkt, als viele wahrscheinlich die Weichen fürs Leben bereits gestellt, einen Beruf gelernt und eine Familie gegründet hatten. Wahrscheinlich waren sie jetzt arbeitslos oder Hartz-IV-Empfänger. Ich kannte Ostdeutsche in meinem Alter, auch in New York, aber ich fürchtete, dass sie nicht besonders repräsentativ waren. Sabine aus Thüringen ist Filmproduzentin, Solveig aus Dresden hat vor der Wende einen Juden aus Amerika geheiratet, Uwe hat in China gelebt, bevor er sich ein Townhouse in Harlem gekauft hat. Als er vor ein paar Monaten 40 wurde, lud er Kollegen von der New York University, deutsche Freunde und die halbe osteuropäische New Yorker Schwulenszene in eine Bar in Chelsea ein. Sein Freund aus Leipzig
legte HipHop auf, auf den Monitoren über der Bar lief der DDR-Film Coming Out mit englischen Untertiteln.
Das war meine letzte Ost-Party.
An einem wolkenlosen New Yorker Spätherbsttag saß ich im Flugzeug nach Berlin. Ich war mir sicher, dass das meine weiteste Zeitreise werden würde. Das Klassentreffen fand in einem Klub an der Warschauer Straße statt. Rechts standen die Männer, links die Frauen, genau wie früher bei der Disko in der Klub-Gaststätte Drushba, die gegenüber unserer Schule war. Es gab Prosecco, Berliner Pilsner, Buletten und Schnittchen. Auf einem Tisch lagen alte DDR-Schulbücher, Schönschrifthefte, FDJ-Abzeichen, Wimpel von den Weltfestspielen der Jugend. Aus den Boxen sang Nena Nur geträumt. Wir erzählten uns unsere Lebensgeschichten. Es war gar nicht so schwer. Hartmut hat sich nach der Wende drei Tankstellen gekauft und eine Firma für Eisenbahnlogistik mit 40 Angestellten aufgebaut. Man kann sich bei ihm Dampflokomotiven ausleihen. Gritta ist Sportpädagogin in einem Jugendzentrum, Ricarda Bauingenieurin. Oliver massiert Rentner in einem Erholungsheim an der Ostsee, im Sommer surft er. Heiko zieht gerade mit seiner Familie nach München um, weil er da eine gute Stelle bei Puma gefunden hat, André ist Eventmanager in der Schweiz, András führt ein Weinrestaurant in Budapest. Steffen, der 1989 über Ungarn in den Westen geflüchtet war, lebt heute wieder in Ostberlin und arbeitet als Sozialbetreuer in der Haftanstalt Tegel. Andreas´ drei Blumenläden sind pleite. Er hält seine Familie mit verschiedenen Jobs über Wasser, arbeitet als Saunaaufgießer, Floristenverbandsgeschäftsführer und Kellner. Es ist vermutlich ein hartes Leben, aber er hat an diesem Abend nicht einmal geklagt. Olaf, der Ruhigste aus unserer Klasse, hat den neuen Airbus mitentwickelt. Er hat mir in jener kalten Berliner Nacht erklärt, was man alles berechnen muss, damit sich so ein schwerer Körper in der Luft halten kann. Ich habe nur das Wichtigste behalten: Man braucht sich keine Sorgen zu machen, mit vielen übergewichtigen
Amerikanern in einer Maschine zu sitzen, weil das Schwerste sowieso der Treibstoff ist.
Milan kam erst kurz vor Mitternacht, direkt aus der Volksbühne. Die Vorstellung von Schuld und Sühne, in der er mitspielte, hatte so lange gedauert. Er trug kein Hemd mit aufgesetzten Schulterstücken.
Das hört sich wahrscheinlich arrogant an, aber meine Klassenkameraden haben mich überrascht. Ich war erstaunt, wie viel sie erlebt haben, wie beweglich sie waren. Ihre Lebensläufe waren weniger geradlinig als die vieler Westdeutscher, sie erinnerten mich eher an die Lebensläufe meiner amerikanischen Freunde, die jede Veränderung in ihrem Leben auch gleichzeitig als Chance begreifen.
Vielleicht ist es aber auch eine Generationsfrage. Vielleicht waren wir damals gerade noch jung genug, um noch einmal neu anzufangen. Vielleicht ist Ostberlin gar nicht so weit von New York entfernt, wie ich immer gedacht habe.Im August ziehe ich nach Berlin zurück.
DIE ZEIT, 13.07.2006 Nr. 29
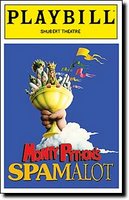 Donnerstag, 7. December 2006
Donnerstag, 7. December 2006 


















